Aus Fehlern lernen – bevor sie passieren.
Patienten berichten, warum sie ein vom Arzt verschriebenes Arzneimittel abgesetzt oder gar nicht erst
eingenommen haben. Ihre Erfahrungen helfen anderen Patienten, bessere Entscheidungen zu treffen.
Jeder kennt den Satz: „Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“
Unsere Aufmerksamkeit richtet sich fast immer auf die Risiken der Einnahme von Arzneimitteln.
Doch kaum jemand denkt an die Risiken des Weglassens: Was passiert, wenn Patient:innen sich entscheiden, ein verschriebenes Medikament gar nicht erst einzunehmen oder eigenmächtig abzusetzen?
Genau darum geht es auf dieser Seite. Wir zeigen, welche Folgen solche Entscheidungen haben können – und wie sie entstehen.
Unter anderem berichten 20 Patient:innen offen über ihre Erfahrungen: Warum sie ihre Therapie abgebrochen haben, welche Konsequenzen das hatte – und was andere daraus lernen können.
Wenn das Auto ein Medikament wäre –
man hätte ihm längst die Zulassung entzogen
Einer der häufigsten Grunde, warum Menschen ein Arzneimittel absetzen, liegt in der Bewertung der möglichen Risiken. Die Risiken des Autofahrens sind bekannt. Die Nebenwirkungen: fast 3.000 Tote pro Jahr allein in Deutschland, Hunderttausende Verletzte. Und doch steigen wir täglich ein – meistens ohne großes Zögern.
Bei Medikamenten genügt dagegen oft ein ungutes Gefühl, um sie abzusetzen. Warum bewerten wir Risiken so unterschiedlich – je nachdem, wie vertraut uns etwas erscheint?
Die Antwort liegt in unserer Wahrnehmung:
Wir überschätzen seltene, aber greifbare Risiken – wie mögliche Nebenwirkungen.
Und wir unterschätzen die schleichenden Gefahren, die entstehen, wenn eine Erkrankung unbehandelt bleibt.
Wir vertrauen dem, was uns vertraut ist – und misstrauen dem, was neu, komplex oder abstrakt wirkt.
Unser Gehirn sortiert Informationen nicht neutral. Es gewichtet sie nach Nähe, Vertrautheit und emotionaler Wirkung.
Die Psychologie nennt das kognitive Verzerrungen.
Sie entstehen unbewusst – und beeinflussen unsere Wahrnehmung von Nutzen und Risiko.
Oft stärker, als wir denken.
Gerade in der Medizin hat das Folgen:
30 bis 50 % der Patient:innen nehmen ein verordnetes Medikament nicht wie empfohlen ein, setzen es vorzeitig ab – oder fangen gar nicht erst damit an.
Die Folge: vermeidbare Komplikationen, Rückfälle, Krankenhausaufenthalte – und jedes Jahr Milliardenschäden im Gesundheitswesen.
Doch hinter diesen Zahlen stehen persönliche Geschichten.
Menschen, die sich falsch entschieden haben – und heute offen erzählen, warum.
Und was sie beim nächsten Mal anders machen würden.
Ihre Erfahrungen können helfen, Denkfehler zu erkennen.
Und Ihre eigene Entscheidung klarer zu treffen.
5 Denkanstöße für gute Entscheidungen
Manche Entscheidungen wirken im Moment richtig – und entpuppen sich später als Fehler.
In vielen Fallgeschichten, die Sie auf dieser Seite finden, zeigt sich:
Es sind oft nicht mangelnde Informationen, sondern unbewusste Denkmuster, die uns in die Irre führen.
Aus diesen Erfahrungen – und gestützt auf die Erkenntnisse der modernen Entscheidungsforschung – haben wir fünf Denkanstöße entwickelt.
Sie sollen helfen, klarer zu sehen, besser zu fragen und klüger zu entscheiden.
Diese Denkanstöße sind keine Regeln.
Sie sind Einladungen zum Innehalten – bevor Sie sich entscheiden.
Sie möchten die Denkanstöße als Broschüre?
Gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro senden wir Ihnen gerne unsere gedruckte Broschüre zu.
Darin werden alle fünf Denkanstöße ausführlich erklärt – jeweils anhand eines konkreten Fallbeispiels.
Sie können selbst entscheiden, welches der 16 Fallbeispiele (s.o.) wir in Ihrer Broschüre verwenden sollen.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und nennen Sie das Fallbeispiel, das für Sie besonders relevant ist.
1. Machen Sie sich bewusst: Fast jede Therapieentscheidung hat zwei Seiten.
Die Entscheidung, ein Arzneimittel einzunehmen oder nicht, gehört zu den komplexeren Entscheidungen im Leben.
In der Entscheidungsforschung spricht man von einer „gemischten Entscheidung“ – also einer Entscheidung, bei der ein möglicher Gewinn und ein möglicher Verlust nebeneinanderstehen.
Das trifft auf viele Therapieentscheidungen zu:
Die gewünschte Wirkung gilt als potenzieller Gewinn – mögliche Nebenwirkungen oder langfristige Folgen hingegen als Verlust (auch wenn viele Patient:innen das so nicht bezeichnen würden).
Das macht solche Entscheidungen emotional anspruchsvoll. Sie fordern uns heraus, erzeugen Unsicherheit, Zögern und das Bedürfnis nach Klarheit – auch wenn die Realität selten eindeutig ist.
Ein Beispiel aus dem Alltag:
Sie überlegen, den Arbeitsplatz zu wechseln. Mehr Gestaltungsspielraum, mehr Sinn, bessere Bedingungen – das klingt nach Gewinn.
Aber Sie wissen auch: Es könnte anstrengender werden. Oder enttäuschend. Oder einfach nicht passen.
Auch das ist eine gemischte Entscheidung – es gibt etwas zu gewinnen, Sie könnten aber auch etwas verlieren; Sie entscheiden unter Unsicherheit)
Ein Beispiel aus der Praxis:
Ein Patient mit Rheuma entscheidet sich nach langer Überlegung gegen ein empfohlenes Medikament.
Nicht, weil er nicht überzeugt ist – sondern weil ihm das Risiko möglicher Nebenwirkungen im Alltag präsenter erscheint als die Aussicht auf eine bessere Beweglichkeit.
Er sagt rückblickend: „Ich habe mich nicht für etwas entschieden – sondern gegen das Risiko. Ich habe mir ganz einfach die falsche Frage gestelt.“
2. Fragen Sie sich: Wie beeinflussen meine Gefühle meine Einschätzung von Risiko und Nutzen?
Der amerikanische Psychologe Paul Slovic gilt als einer der führenden Risikoforscher weltweit.
Seine Studien zeigen: Wir beurteilen Risiken nicht nur rational – sondern auch emotional.
Unsere Einschätzung wird stark davon beeinflusst, wie vertraut, kontrollierbar oder greifbar uns ein Risiko erscheint.
Ein Beispiel: Viele Menschen steigen täglich ins Auto, obwohl sie wissen, dass im Straßenverkehr jedes Jahr Tausende Menschen ums Leben kommen.
Das Risiko wird akzeptiert – weil Autofahren vertraut ist, weil man das Gefühl hat, es selbst zu steuern, und weil die Gefahr meist nicht sichtbar ist.
Medikamente dagegen wirken abstrakt, technisch, fremd.
Sie vermitteln weniger Kontrolle – und werden deshalb oft als bedrohlicher wahrgenommen, selbst wenn ihr Nutzen gut belegt ist.
Slovic nennt das die Affektheuristik:
Unsere Gefühle beeinflussen, wie gefährlich oder wie sicher uns etwas erscheint.
Was Angst macht oder negativ belegt ist, erscheint riskanter.
Was vertraut, positiv oder alltäglich ist, wirkt harmloser – selbst wenn es das objektiv nicht ist.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Eine Patientin mit Asthma soll ein neues inhalatives Kortisonpräparat anwenden.
Obwohl sie regelmäßig Beschwerden hat, zögert sie – das Wort „Kortison“ löst Angst aus.
Sie sagt: „Ich habe sofort an schlimme Nebenwirkungen gedacht – obwohl ich das Medikament gar nicht richtig kannte.“
Erst durch das Gespräch in der Apotheke konnte sie das Risiko realistisch einordnen – und sich bewusst für die Therapie entscheiden.
3. Achten Sie darauf, wonach Sie suchen – und was Sie dabei übersehen.
Wir alle neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die unsere eigene Meinung bestätigen.
In der Psychologie nennt man das den Bestätigungsfehler (Confirmation Bias).
Anfangs suchen wir nach Bestätigung für eine Entscheidung – später, wenn Zweifel wachsen, suchen wir gezielt nach Argumenten dagegen.
Was uns in einem Moment überzeugt hat, erscheint im nächsten als fragwürdig – nicht unbedingt, weil sich die Fakten geändert haben, sondern weil sich unser Fokus verschoben hat.
Dieser Denkfehler betrifft nicht nur Gesundheitsfragen. Studien zeigen: Selbst bei widersprüchlichen Informationen nehmen wir meist nur das wahr, was zu unserer Sicht passt.
Was nicht dazu passt, wird abgewertet, angezweifelt oder gar nicht erst wahrgenommen.
So entsteht ein verzerrtes Bild – und mit jeder Suche, jedem Klick, jeder selektiven Erinnerung wird es stabiler.
Je länger dieser Prozess andauert, desto schwerer fällt es, eine Entscheidung zu hinterfragen oder neu zu bewerten.
Ein Perspektivwechsel kann helfen:
Statt sich zu fragen „Soll ich das Medikament weiternehmen – ja oder nein?“ wäre die bessere Frage:
„Wie kann ich mich am besten schützen?“
Die erste Frage verengt, die zweite öffnet den Denkraum.
4. Verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Gefühl – sondern auf gute Gründe.
Viele Menschen treffen medizinische Entscheidungen nach dem Bauchgefühl – auch wenn sie vorher viele Informationen gesammelt haben.
Das Gefühl wirkt wie eine innere Abkürzung: überzeugend, eindeutig, vertraut. Doch genau darin liegt die Gefahr.
Der amerikanische Nobelpreisträger Herbert A. Simon hat es treffend beschrieben:
Unsere Entscheidungen sind begrenzt – durch unser Wissen und durch unsere Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten.
Wir haben nie den vollständigen Überblick. Und selbst wenn, könnten wir ihn kaum vollständig durchdenken.
Deshalb greifen wir zu intuitiven Entscheidungen – oft unbewusst.
Intuition ist nicht grundsätzlich falsch.
Aber sie funktioniert nur dann gut, wenn wir Erfahrung in einem Bereich haben.
Ein erfahrener Arzt kann sich bei einer Diagnose teilweise auf sein Bauchgefühl verlassen.
Bei einer medizinischen Laienentscheidung fehlt diese Erfahrungsbasis – das Bauchgefühl nährt sich dann aus Eindrücken, Geschichten, Befürchtungen oder Halbwissen.
Das Problem:
Eine Entscheidung, die sich gut anfühlt, ist nicht automatisch eine gute Entscheidung.
Gerade in der Medizin kann das Gefühl trügen – besonders dann, wenn der Nutzen leise wirkt, aber die Risiken emotional laut werden.
Ein Moment zum Innehalten:
Fragen Sie sich nicht nur: Fühlt sich das richtig an?
Sondern auch: Was spricht sachlich dafür – und was dagegen?
Ein gutes Gefühl ist hilfreich. Aber es ersetzt keine guten Gründe.
5. Stellen Sie bessere Fragen – dann treffen Sie auch bessere Entscheidungen.
Viele Entscheidungen wirken auf den ersten Blick einfach.
Gerade in der Medizin neigen wir dazu, komplexe Fragen unbewusst durch einfache zu ersetzen – weil sie sich leichter beantworten lassen.
Die Psychologie nennt das Frageersetzung.
Statt zu fragen:
„Wie wirkt dieses Medikament auf mein Risiko?“,
denken viele:
„Brauche ich das überhaupt – wo es mir doch gut geht?“
Was wie eine vernünftige Frage klingt, ist in Wahrheit eine Vereinfachung – und kann in die Irre führen.
Denn: Wie man sich fühlt, sagt oft wenig darüber aus, wie hoch ein medizinisches Risiko wirklich ist.
Hinzu kommt eine zweite Denkfalle: Wir formulieren Entscheidungen oft als Ja-/Nein-Fragen.
„Soll ich das Medikament weiternehmen – ja oder nein?“
Solche Fragen wirken klar, aber sie verengen den Blick.
Besser wäre:
„Wie kann ich mich am besten schützen?“
Oder: „Welche Alternativen habe ich – und was spricht jeweils dafür oder dagegen?“
Offene, lösungsorientierte Fragen helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen.
Und sie öffnen Raum für Gespräche – mit Ärzt:innen, Apotheker:innen oder anderen Vertrauenspersonen.
Denn gute Entscheidungen beginnen oft mit einer besseren Frage.
Ein E-Learning Modul nicht nur für Patienten
Was Entscheidungsforschung für Ihren Alltag leisten kann.
Wie Menschen Entscheidungen treffen, gehört zu den am besten erforschten Fragen der Verhaltensökonomik. Dieses E-Learning-Modul macht dieses Wissen verständlich und alltagstauglich. Es zeigt, warum wir uns manchmal falsch entscheiden – und wie wir es schaffen, klarer zu denken und bessere Entscheidungen zu treffen.
Das Modul richtet sich nicht nur an Patienten. Die Beispiele stammen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen: aus dem privaten Alltag, aus dem Berufsleben und aus typischen Entscheidungssituationen, in denen wir alle stehen. So wird das Gelernte unmittelbar greifbar – und lässt sich direkt im eigenen Leben anwenden.
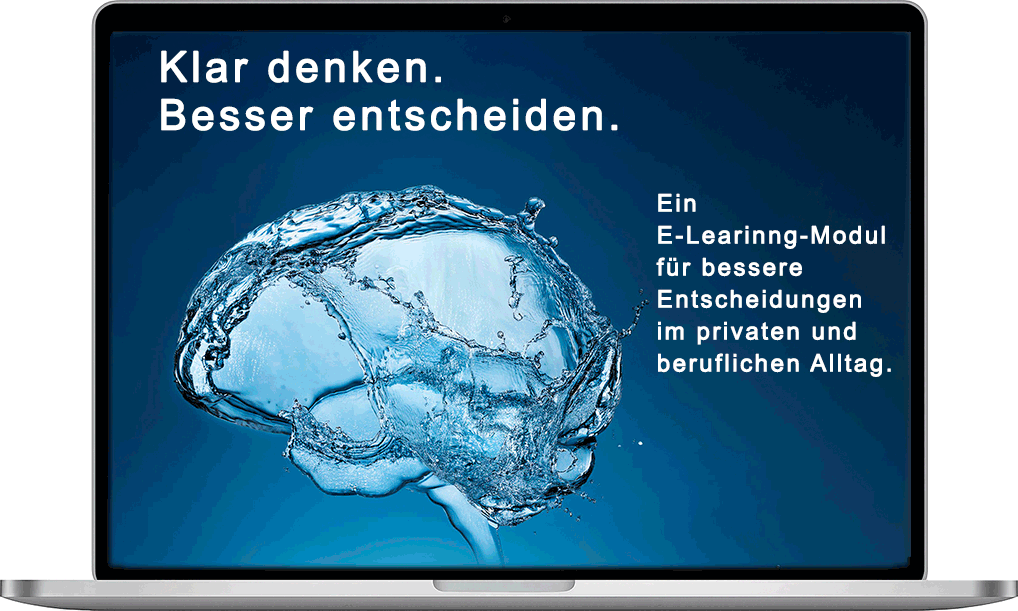
Wenn die Umsetzung der Therapie schwerfällt
Hier finden Sie Ideen und Tipps
Viele Patient:innen nehmen verschriebene Medikamente nicht wie vorgesehen ein. Oft sind es die Denkmuster, die wir auf dieser Website bereits beschrieben haben.
Aber manchmal ist es einfach Vergesslichkeit, die dazwischenkommt. Das Gute ist: Für viele dieser ganz alltäglichen Hürden gibt es einfache, wirkungsvolle Lösungen, die helfen, gute Entscheidungen auch im Alltag umzusetzen.
👉 Per Klick auf diesen Link stellen wir Ihnen einige dieser Lösungen vor – konkret, alltagstauglich und leicht umsetzbar.
Sie glauben "der" Pharmaindustrie nicht?
Dann sprechen Sie mit den Menschen, die dort arbeiten.
Viele Menschen vertrauen Anbietern sogenannter „alternativer Heilmethoden“ mehr als Ärzten, Apothekern oder gar der Pharmaindustrie. Die Gründe dafür sind vielfältig – und nicht immer unbegründet. Doch eines sollten Sie wissen:
Bevor ein Arzneimittel auf den Markt kommt, durchläuft es festgelegte, streng kontrollierte Prozessschritte. Dahinter stehen Millioneninvestitionen in Forschung und Entwicklung – und ebenso hohe Kosten für Studien, die Wirksamkeit und Sicherheit nachweisen müssen, bevor eine Zulassung erteilt wird.
Fragen Sie sich:
Auf welcher Ausbildung basiert das Angebot einer „alternativen“ Methode?
Beschränkt sich ihre „Forschung“ auf Einzelfallberichte – oder erfüllt sie die gleichen strengen Standards wie die Arzneimittelforschung?
Wenn Sie Zweifel daran haben, dass ein Arzneimittel wirklich intensiv erforscht ist oder dass dabei fair und korrekt gearbeitet wird, dann sprechen Sie direkt mit den Menschen, die nah dran sind: Arzneimittelforscher:innen, Studienleiter:innen, Produktmanager:innen.
Schreiben Sie uns, mit wem Sie sprechen möchten. Wir sammeln Ihre Themenwünsche und organisieren Webinare – mit denjenigen, die in Pharmaunternehmen Verantwortung für Ihre Sicherheit tragen.

